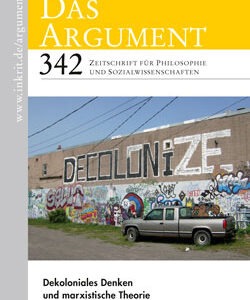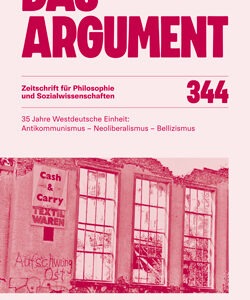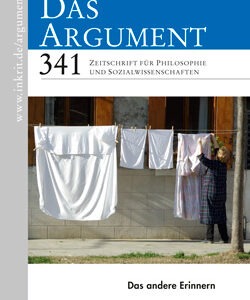Beschreibung
Editorial:
Hobsbawms Titel vom Zeitalter der Extreme hat etwas Missliches: Er bietet sich all denen an, die, aus der sicheren Mitte argumentierend, in Eins mit dem autoritären Staat jegliche Alternative zur Alleinherrschaft des kapitalistischen Marktes erledigt sehen. Diese Orientierung erstreckt sich auch auf das philosophische Erbe des 20. Jahrhunderts: Man bedauert, dass zahlreiche seiner Exponenten der Versuchung des politischen Extremismus erlegen sind, und geht zu einer Tagesordnung über, in der wieder Kant und Hegel, Platon und Aristoteles das Wort führen – etwa als Vorväter von Liberalismus und Kommunitarismus.
Nun lässt freilich bereits das begriffliche Schema von Mitte und Extremen verschiedene Lesarten offen: Es ist in keiner Weise zwingend, in der Mitte die Demokratie und an den Rändern die totalitären Alternativen zu verorten; ebensogut kann man ein Kontinuum annehmen, das sich von dem Extrem des universellen Anspruchs auf Freiheit und Gleichheit über die Mitte der durch Marktzwänge restringierten Privatfreiheit und der formalen Rechtsgleichheit bis zum anderen Extrem der diktatorisch zementierten Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse erstreckt. Für die Philosophie und Sozialtheorie des 20. Jahrhunderts ist die Frage jedoch noch einmal anders zu stellen: Wie schreibt sie sich in gesellschaftliche Gegebenheiten ein, welche Alternativen hat sie zu bieten? Auf diese Weise kommen verschiedene Extremverhältnisse zum Status Quo in den Blick: Er kann in seiner Gesamtheit bestätigt oder abgelehnt werden. Für die zweite Möglichkeit stünden etwa Benjamins geschichtsphilosophische Thesen und Horkheimer/Adornos Dialektik der Aufklärung, für die erste Max Webers Modell einer unhintergehbaren Rationalisierung oder Wittgensteins Rekurs auf die Sprachnormalität. Es ist deutlich, dass beide Positionen eine bestimmte Negation bestimmter Verhältnisse verhindern.
Nun haben aber gerade die Theoretiker der Linken (inklusive Horkheimer, Adorno und Benjamin) in den späten 1920er und den frühen 1930er Jahren diese Negation geleistet – während sie sich zugleich der faktischen Schließung von Handlungsperspektiven gegenübersahen. Intellektuelle der Rechten wie Heidegger und Carl Schmitt hingegen, die ebenfalls auf radikale politische Veränderungen ausgingen, arbeiteten an der Befestigung alter Unterordnungsverhältnisse mit neuen Mitteln. Wenn hier erneut beide Linien vergleichend in den Blick genommen werden, so deshalb, weil sich hinter ihrer postextremistischen Gleichsetzung das andere theoretische Extrem der klassischen Moderne verbirgt: die Behauptung, die herrschende Form kapitalistischer Rationalisierung sei hinzunehmen, weil mögliche Alternativen den Rahmen des sozial Machbaren und demokratisch Vertretbaren sprengten. Im Raum der Alternativen sind jedoch Unterscheidungen anzubringen – daher und nur daher lässt sich ein Erbe der klassischen Moderne erschließen.
Zu Heidegger nehmen zwei Artikel Stellung, die jeweils sowohl die Chancen seines Projekts als auch deren autoritäre Einschmelzung diskutieren: Thomas Heinrichs untersucht seine philosophische Aufnahme von Mustern fordistischer Vergesellschaftung, und Susanne Lettow stellt in ihrem Text über den Begriff der Hörigkeit dar, wie Heidegger auf antipatriarchalischer Basis einen neuen Ursprungsmythos konzipiert. Weber, der Hauptbezugspunkt zahlreicher antiextremistischer Theorien der Moderne, kommt über seine Rezeption zu Wort: Yasushi Yamanouchi stellt seine Faschisierung in der japanischen Soziologie dar. Der Artikel über Traditionelle und moderne Philosophie setzt sich mit neueren Versuchen auseinander, im Diskurs der Weimarer Intellektuellen eine Strukturäquivalenz zwischen Rechts und Links nachzuweisen. Frigga Haug schließlich zeigt am Beispiel von Brechts Flüchtlingsgesprächen, dass sich die Möglichkeiten radikaler Philosophie keineswegs in totalisierenden Abschlussgesten erschöpfen.