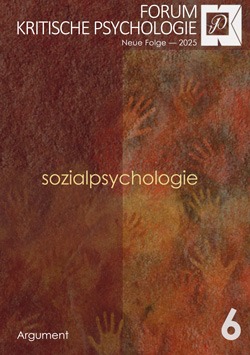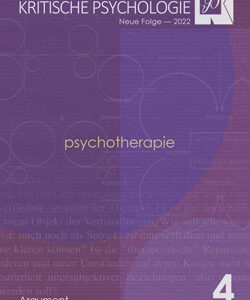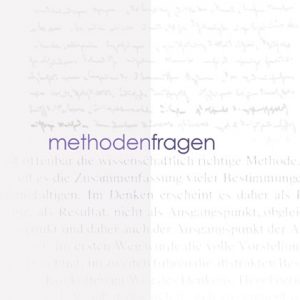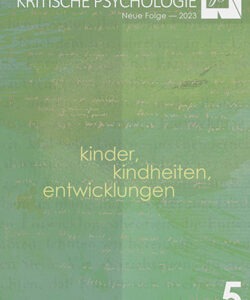Beschreibung
FKP/NF 06
Sozialpsychologie
Auf den ersten Blick sollte man meinen, dass ein marxistischer und sozialwissenschaftlich fundierter Ansatz wie die Kritische Psychologie im Fach Sozialpsychologie, das den Begriff des Sozialen im Namen trägt, besonders gut aufgehoben sein sollte. »Die Sozialpsychologie«, schreibt Morus Markard (2018), sei »die Teildisziplin, die am ehesten auf den Gesellschaftsbezug der Psychologie« verweise, sofern man davon ausgehe, dass »unsere Handlungen, unsere sozialen Beziehungen und die Art und Weise, wie wir fühlen und über uns und die Welt denken, gesellschaftlich vermittelt sind.« (Markard, 2018, S. 108) Aus Anlass des vorliegenden Heftschwerpunkts soll hier der Frage nachgegangen werden, warum die vorfindliche akademische Sozialpsychologie einen solchen Gesellschaftsbezug allerdings nicht in überzeugender Weise herstellt und wie ihr Verhältnis zur Kritischen Psychologie näher bestimmt werden könnte.
Eröffnet wird der Schwerpunkt mit einer Analyse und Kritik des sozialpsychologischen Einstellungskonzepts durch Morus Markard. In seinem in englischer Sprache 1991 publizierten und hier erstmals auf Deutsch vorliegenden Aufsatz problematisiert der Autor aus kritisch-psychologischer Sicht verschiedene Aspekte von Einstellungskonstrukten; dazu gehören deren definitorische Beliebigkeit, die Sachentbundenheit und Tendenz zur Stereotypisierung – so lassen sich Einstellungen zu nicht-existierenden »Ethnien« »messen« –, die Zumutungen, die entsprechende Skalen für Befragte bedeuten und die Irrelevanz für Verhaltensvorhersagen. Markard kommt zu dem Schluss, dass zwar das Konstrukt unhaltbar sei, dass aber eine »›einstellungsförmige‹ Welt- und Selbstbegegnung« die bewusste Lebenspraxis behindern und damit zum Gegenstand kritisch-psychologischer Forschung werden könne. In seiner Vorbemerkung anlässlich der (Wieder-) Veröffentlichung des Textes verweist Markard unter anderem auf aktuelle Debatten um Einstellungsmessungen zu Antisemitismus, Autoritarismus und ähnlichen Konstrukten. Die Befragten müssten sich i.d.R. zu den vorgegebenen Items positionieren ohne die Möglichkeit, Differenzierungen, Widersprüche oder Mehrdeutigkeiten zu thematisieren, zugleich bleibe das Interpretationsmonopol bei den Fragenden.
Daniel Schnur setzt sich in seinem Aufsatz mit der Theorie der sozialen Identität (Social Identity Theory, SIT) auseinander. Vor einem wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund zeigt er die Bemühungen Tajfels, mittels der SIT den Individualismus der US-amerikanischen Mainstream-Psychologie zu überwinden und zugleich einen theoretischen Ansatz vorzulegen, mit dessen Hilfe Phänomene der Gruppenbildung und Diskriminierung empirisch untersucht werden können. Ungeachtet dieses Anspruchs, so Schnur, gebe es in der SIT aber einen immer schon vorausgesetzten Dualismus von Eigen- und Fremdgruppe; vernachlässigt würden in der SIT unter anderem der Unterschied zwischen unmittelbar sozialen und vermittelten gesellschaftlichen Beziehungen sowie die empirisch-praktische Möglichkeit, den Gegensatz von Eigen- und Fremdgruppe in Richtung einer gemeinsamen Teilhabe an der Verfügung über die gesellschaftlichen Bedingungen zu überwinden. Im Sinne der Kritischen Psychologie könnten soziale Gruppenzugehörigkeiten und -konflikte als Bedeutungsanordnungen verstanden werden.
In einer empirischen Studie befasst sich Grete Erckmann mit dem Leben in sogenannten städtischen Problemvierteln. Zunächst rekonstruiert sie historische Aspekte der Entstehung solcher Viertel und betont dabei insbesondere Dynamiken des Kapitalismus bzw. Neoliberalismus sowie Rahmenbedingungen von Migration. Im Anschluss daran identifiziert sie typische Probleme und Bewältigungsweisen von jungen Menschen, die potenziell zur Zielscheibe von Rassismus und zum Objekt von Migrationsdiskursen gemacht werden. Dabei stützt sich die Autorin auf Daten, die im Zuge von Fallstudien und insbesondere ethnografischer Beobachtungen und Interviews gewonnen wurden. Vor diesem Hintergrund diskutiert Erckmann, wie das erstmals von Henri Lefebvre formulierte »Recht auf Stadt« politisch zu verwirklichen wäre. Der Beitrag von Erckmann ist, wie auch der von Schnur, zunächst 2024 auf Englisch im Annual Review of Critical Psychology erschienen und wird hier in deutscher Sprache und gekürzter bzw. überarbeiteter Form veröffentlicht.
Die theoretischen Grundlagen einer subjektwissenschaftlichen Wohnforschung skizziert Karl-Heinz Braun. Dabei greift er auf Arbeiten von André Hahn zurück, einem profilierten Vertreter der phänomenologischen Architekturtheorie, außerdem betont er Aspekte der politischen Ökonomie und der sozialen Ungleichheit des Wohnens. Wohnen begreift Braun als ein in gesellschaftliche Strukturen eingebettetes Alltagshandeln, das aus der Perspektive der Subjekte zu verstehen ist. Wie Erckmann verknüpft er seine Überlegungen mit Lefebvres »Recht auf Stadt«. Die Darlegung einer empirischen Bedingungs-, Bedeutungs- und Begründungsanalyse des Wohnens, die sich auf Genre und Methode der Sozialreportage stützt, stellt der Autor für einen späteren Aufsatz in Aussicht.
Wolfgang Maiers befasst sich mit Kulturpsychologie aus subjektwissenschaftlicher Sicht. Er plädiert – unter anderem mit Bezug auf den »kulturhistorischen« Ansatz von Lew Wygotski – für eine »durch marxistische Gesellschaftstheorie fundierte subjektwissenschaftliche Orientierung der Kulturpsychologie«, die berücksichtigt, wie gesellschaftliche Verhältnisse die »Möglichkeitsräume personaler Handlungsfähigkeit« bestimmen. Derart könne man den »Gesellschaftsbegriff um eine handlungsrelevante Dimension erweitern, indem er einen Zugang zur Perspektive der individuellen Akteure, dem Welt- und Selbstverständnis sozialer Gruppen und der Vielfalt und Veränderlichkeit soziokultureller Kodierungen von Lebenswelten und Subjektivitäten« ermögliche. Es gelte, »alltagspraktische Bedeutungsmuster der Produktions- und Lebensweise« so zu untersuchen, dass sich angesichts zu analysierender Restriktionen den Subjekten »erweiterte Möglichkeitsräume für selbstbestimmtes individuelles und kollektives Handeln eröffnen.«
Psychologische Interventionen zur Veränderung des Umweltverhaltens kritisieren Nora Räthzel und David Uzzell. Gegen individualistische Theorien, die auf falschen Voraussetzungen beruhen – etwa auf Thesen über den von Natur aus egoistischen Menschen oder die angeblich unvermeidliche »Tragik der Allmende« –, setzen sie eine kritische Sozial- und Umweltpsychologie, in deren Mittelpunkt Handlungsfähigkeit und die Teilhabe an der gemeinsamen Verfügung über die Lebensbedingungen stehen.
Das vollständige Editorial zum Download
Redaktion dieser Ausgabe: Felix Bardorf, Ulrike Eichinger, Christian Küpper, Hans-Peter Michels, Thomas Pappritz, Daniel Schnur, Santiago Vollmer, Michael Zander
Kontakt: fkp@kritische-psychologie.de
Inhalt
■ Michael Zander: Kritische Psychologie und Sozialpsychologie: Zur Einführung in den Heftschwerpunkt
■ Morus Markard: »Einstellung« – eine kategorial-analytische Kritik
■ Daniel Schnur: Tajfels Theorie der Sozialen Identität aus kritisch-psychologischer Perspektive
■ Grete Erckmann: Leben in urbanen »Problemvierteln« in einer Migrationsgesellschaft. Über den Umgang mit Problemen und das Recht auf Stadt
■ Karl-Heinz Braun: Subjektwissenschaftliche Erforschung von Wohnarchitektur. Ein Vorschlag zur erweiterten und vertieften Kooperation zwischen Phänomenologie und Kritischer Psychologie – am Beispiel der Arbeiten von Achim Hahn
■ Nora Räthzel & David Uzzell: Psychologische Interventionen zur Veränderung des Umweltverhaltens – eine Kritik
■ Wolfgang Maiers: Kulturpsychologie aus subjektwissenschaftlicher Perspektive
■ Monique Lathan: Kreatives Problemlösen als Schlussfolgern rückwärts. Oder: Auf welchen Prämissen beruht unser Alltagshandeln?
Rezensionen
Roland Imhoff (Hrsg.): Die Psychologie der Verschwörungstheorien (Felix Bardorf)
Rutger Bregman: Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit (Robin Ebbrecht)